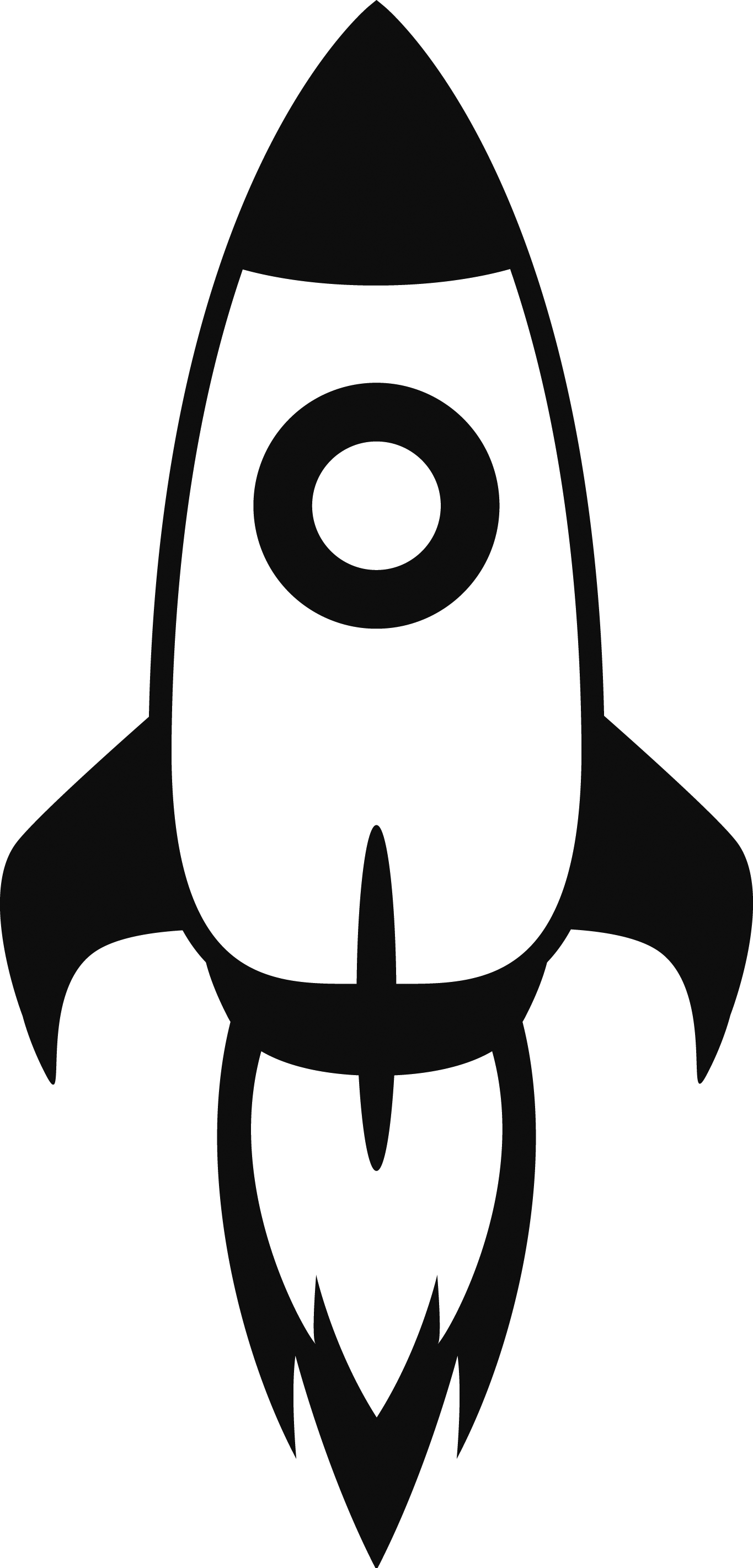
Innovative Mobilitätsprogramme für Patient:innen in Schweizer Spitälern
Felline, Elloy & Degenhardt, Phillip, 2025
Art der Arbeit Bachelor Thesis
Auftraggebende Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Hochschule für Wirtschaft Institute for Competitiveness and Communication
Betreuende Dozierende Dettwiler, Raymond
Views: 25

Bewegungsmangel im Spital führt bei vielen Patient:innen zu funktionellen Einschränkungen (Hospital-Associated Disability). Trotz bekannter Risiken fehlt es in Schweizer Spitälern häufig an systematischen Strategien zur Mobilitätsförderung und an einer festen Verankerung von Bewegung im klinischen Alltag. Ziel war es, internationale Mobilitätsprogramme zu analysieren und deren Übertragbarkeit auf den Schweizer Kontext zu prüfen.
Die Arbeit kombiniert eine systematische Literaturrecherche mit vier Experteninterviews aus den USA, den Niederlanden und Australien. Analysiert wurden Organisationsmodelle, Prozessgestaltung, interprofessionelle Zusammenarbeit sowie Evaluations- und Steuerungsinstrumente. Die Ergebnisse wurden vergleichend ausgewertet und in praxisorientierte Handlungsempfehlungen für Schweizer Spitäler übertragen.
Die Analyse zeigt vier zentrale Erfolgsfaktoren für nachhaltige Mobilitätsförderung: Führung und strategische Verankerung, klare Rollen im Team, datenbasierte Feedbacksysteme sowie Integration der Mobilität in bestehende Abläufe. Internationale Modelle wie JH-AMP (Johns Hopkins Activity and Mobility Promotion) aus den USA, Hospital in Motion aus den Niederlanden und Eat Walk Engage aus Australien demonstrieren, dass Mobilität am wirksamsten gefördert wird, wenn sie als selbstverständlicher Teil der Behandlungskultur verstanden wird. Für Schweizer Spitäler ergibt sich daraus die Empfehlung, Mobilitätsziele in Visiten und Pflegeplanung zu integrieren, bestehende Alltagsstrukturen zu nutzen, interprofessionelle Zuständigkeiten klar zu definieren und erreichte Fortschritte sichtbar zu machen. Dies kann nicht nur die funktionelle Selbstständigkeit der Patient:innen verbessern, sondern auch die Aufenthaltsdauer verkürzen und nachgelagerte Versorgungsbereiche entlasten.
Studiengang: Betriebsökonomie (Bachelor)
Keywords Patientenmobilität, Bewegungsförderung, Mobilitätsprogramme, International
Vertraulichkeit: vertraulich
Art der Arbeit
Bachelor Thesis
Auftraggebende
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Hochschule für Wirtschaft Institute for Competitiveness and Communication, Olten
Autorinnen und Autoren
Felline, Elloy & Degenhardt, Phillip
Betreuende Dozierende
Dettwiler, Raymond
Publikationsjahr
2025
Sprache der Arbeit
Deutsch
Vertraulichkeit
vertraulich
Studiengang
Betriebsökonomie (Bachelor)
Standort Studiengang
Brugg-Windisch
Keywords
Patientenmobilität, Bewegungsförderung, Mobilitätsprogramme, International